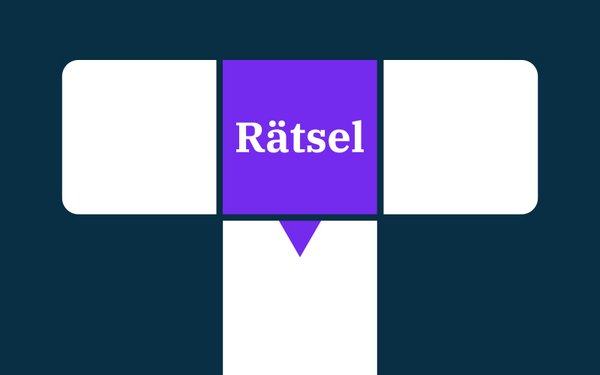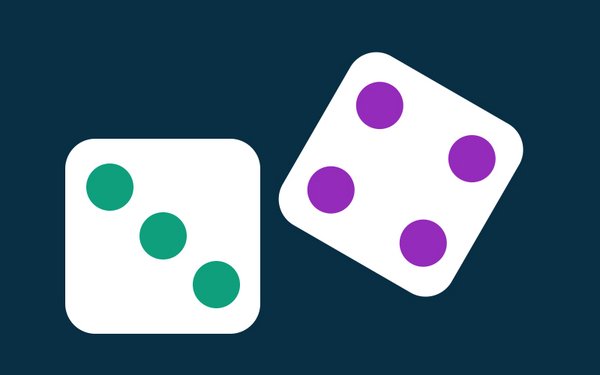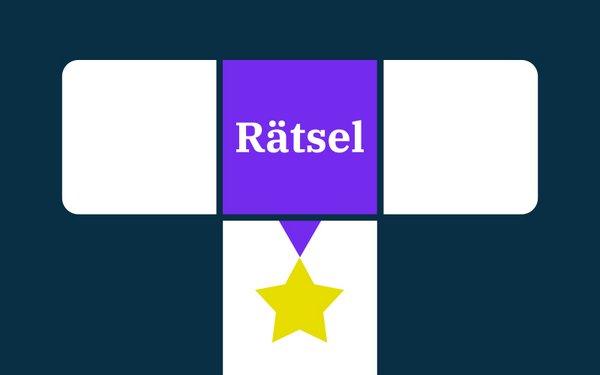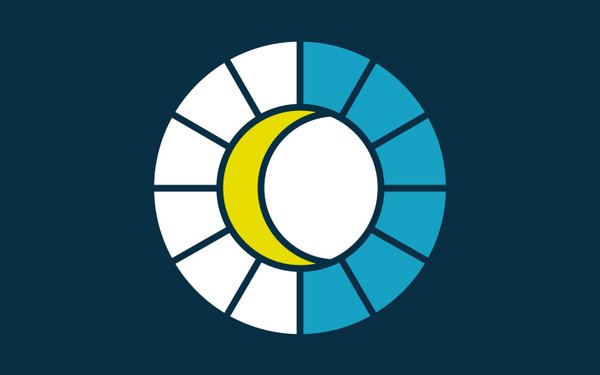ALTER
Hurra, wir leben einiges länger!

Und Alten wie Jungen im Beruf endlich mehr zutrauen, schreibt Antje Schrupp.
In Deutschland leben inzwischen mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige. Die Gruppe der über 80-Jährigen ist seit den Fünfzigerjahren sogar von einem Prozent auf rund 6 Prozent angestiegen.
Dieser "demografische Wandel" wird häufig negativ bewertet. Alt werden, so glauben viele, ist nichts Gutes, erst recht nicht für ein ganzes Land. Aber ist das wirklich wahr? Noch immer ist die einzige Alternative zum Altwerden das frühe Sterben, das stimmt nicht nur für Einzelne, sondern auch für Gesellschaften.
Der Hauptgrund für den demografischen Wandel ist jedenfalls nicht, wie viele meinen, die sinkende Geburtenrate. Die 1945 geborenen Frauen haben im Schnitt 1,8 Kinder bekommen, die 1966 geborenen Frauen 1,5 - ein eher kleiner Rückgang.
Der viel, viel wichtigere Faktor ist die steigende Lebenserwartung: 1871 geborene Mädchen hatten in Deutschland eine Lebenserwartung von 42 Jahren, bei den 1930 Geborenen war sie schon auf 72 Jahre gestiegen, und heute geborene Mädchen können sich darauf einstellen, dass sie 90 Jahre alt werden - im Durchschnitt.
Für jedes 2017 geborene Mädchen, das "schon" mit 80 Jahren stirbt, wird ein anderes 100 werden.
Gesellschaftliche Strukturen müssen sich ändern
Der demografische Wandel ist also keineswegs ein Anlass zur Klage, sondern zur Freude: Hurra, wir leben länger! Niemand will doch wohl den Zeiten hinterhertrauern, als viele Kinder schon in den ersten Lebensjahren starben, Geburten ein hohes Risiko für junge Frauen waren und Menschen jeden Alters an Krankheiten oder Unfällen starben, die wir inzwischen heilen oder vermeiden können.
Es ist ein unvorstellbarer Luxus, dass heute die meisten von uns erst sterben, wenn sie schon alt sind - das hat es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben.
Allerdings müssen wir unsere gesellschaftlichen Strukturen auf so eine grundsätzliche Veränderung einstellen, und da gibt es leider erhebliche Defizite. Zum Beispiel reden wir immer noch von "Rentenversicherungen".
Das war um 1870, als die Rentenversicherung (für männliche Industriearbeiter) eingeführt wurde, auch sinnvoll: Man hat sich für den unwahrscheinlichen Fall versichert, dass man tatsächlich so alt würde.
Heute aber, wo die allermeisten Menschen das Rentenalter nicht nur erreichen, sondern danach noch weitere 20 oder 30 Jahre leben, kann man die materielle Absicherung von Rentnerinnen und Rentnern nicht mehr in der Logik einer "Versicherung" organisieren.
Eine Versicherung, bei der der Versicherungsfall praktisch immer eintritt, ist schnell pleite. Anderes Beispiel: Noch immer organisieren wir Arbeitsbiografien nach dem Motto des klassischen "Senioritätsprinzips" - je älter, desto höher in der Hierarchie, desto mehr Geld und mehr Einfluss.
Auch das spiegelt eine Gesellschaft, in der nur wenige Menschen alt werden. Nur dann ist nämlich deren Erfahrung und Expertise etwas Besonderes und damit auch besonders wertvoll.
Heute stellen sich aber ganz andere Herausforderungen. Es muss darum gehen, unterschiedliche Begabungen und Voraussetzungen möglichst gut miteinander zu vernetzen - auch Junge haben manchmal den Alten etwas voraus.
Es kommt nicht nur auf die Jahreszahl an
Wir brauchen also mehr Flexibilität im Verlauf des Lebens, und die Diskussionen dazu müssen weit über die Frage hinausgehen, ob das richtige Renteneintrittsalter bei 67 oder 70 Jahren liegt.
Vor allem ist zu berücksichtigen, dass alte Menschen nicht alle über einen Kamm geschert werden können. Wir messen das Alter meist am Kalender: Alle Sechsjährigen gehen in die Schule, und ab 18 darf man wählen und so weiter.
Das ist bei jungen Leuten auch sinnvoll, weil sich Sechsjährige und 18-Jährige, was ihren Entwicklungsstand und ihre Fähigkeiten betrifft, relativ ähnlich sind. Aber bei 60- oder 80-Jährigen stimmt das nicht.
Der eine ist mit 65 von zahlreichen Krankheiten geplagt, vielleicht auch, weil er einen körperlich anstrengenden Beruf ausgeübt hat, und kann beim besten Willen nicht mehr arbeiten gehen.
Die andere hingegen ist mit 75 noch topfit, und es gibt überhaupt keinen Grund, sie in Rente zu schicken. Schon gar nicht, wenn sie die Möglichkeit hat, ihre Stundenzahl etwas zu reduzieren.
Neben der schnöden Jahreszahl gibt es jedenfalls noch viele andere Kategorien, in denen sich Alter beschreiben lässt: das biologische Alter (die körperliche Fitness), das psychologische Alter (wie alt man sich fühlt), das soziale Alter (eine 30-jährige Tennisspielerin ist "alt", ein 50-jähriger Politiker "jung") und so weiter.
Eine Gesellschaft, die aus mehr alten als jungen Menschen besteht, braucht dringend neue Kriterien und Wahrnehmungsraster, wenn sie das Alter realistisch betrachten, also weder dramatisieren noch schönreden will.
Wir sind "Leistungsträger" und "Hilfsbedürftige"
Denn es stimmt natürlich schon, dass man mit 60 oder 70 nicht mehr alles genauso machen kann wie mit 30 oder 40. Aber das bedeutet im Umkehrschluss eben nicht, dass man mit 70 aufs Altenteil gehört, obwohl man wahrscheinlich noch 20 Jahre lebt.
Wir müssen uns als Gesellschaft darauf einstellen, dass die meisten Menschen zwar vieles können, aber eben nicht (mehr) alles. Der eine kann gut körperlich arbeiten, ist aber ein bisschen vergesslich.
Die andere kann fantastisch kochen, aber sich nicht mehr zum Putzen bücken. Der Dritte ist ein super Buchhalter, braucht aber einen Rollstuhl. Ja, und? Nur eine Gesellschaft, in der fast niemand alt ist, kann es sich leisten, Menschen in genau zwei Sorten einzuteilen, nämlich sogenannte "Leistungsträger" und "Hilfsbedürftige".
In Wirklichkeit gehören wir alle zu beiden Kategorien: Niemand kann vollständig für sich selbst sorgen, und wir alle sind an der einen oder anderen Stelle auf Hilfe angewiesen.
Diese Lektion werden wir hoffentlich durch das Zusammenleben mit immer mehr älteren Menschen lernen. Und wenn wir das bei der Gestaltung unserer Infrastruktur beherzigen, dann ist der demografische Wandel überhaupt kein Anlass zur Sorge.
Denn eine Welt, die für Alte gut eingerichtet ist, ist für alle gut eingerichtet.
Zur Person: Antje Schrupp ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Zum Thema erschien ihr Buch "Methusalems Mütter. Chancen des demografischen Wandels" (Ulrike-Helmer-Verlag, Sulzbach).
Jetzt abonnieren und gewinnen! 
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an und nehmen Sie automatisch an der nächsten Verlosung des Preisrätsels teil.